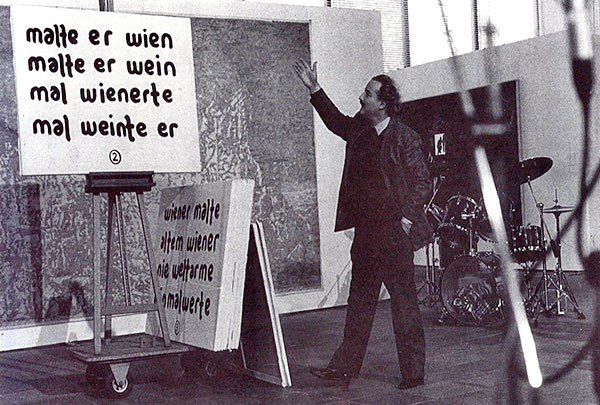Mit viel Sprach- und Zeitaufwand hat ein Autor ein Gedicht gefügt.
Jetzt ist das Sprachwerk da, aber es lässt gleichgültig, es aktiviert
kein Wohlgefallen.
Der Autor, der allein steht, laut Gottfried Benn der Stummheit und
der Lächerlichkeit preisgegeben (Probleme der Lyrik, In: GB
Das Hauptwerk, 1980, S. 340) hat ein Bewusstsein von seinem
sprachlichen Bemühen, dazu gehört, dass sein Versuch misslingen
kann. Doch Lektoren und Kritiker wollen an diese Möglichkeit
gar nicht denken, sie wollen nicht dazusagen, dass Dichten jederzeit
misslingen kann, auch bei denen, die sie als Genies entdeckt
haben. Sie verharmlosen die poetische Arbeit und vertuschen
durch den Kult der großen Namen, dass auch bekannte Autoren
mit jedem neuen Werk von vorn beginnen müssen.
Eine unbekannte Autorin, als Beispiel für das ständig drohende
Misslingen. Milena Merlak (Detela) in Log 2/1979:
Warum bist du so grell lebendig, dass du nicht dunkel leben kannst?
Du liebst den fröhlichen Buchstaben o, du willst den großen Buchstaben
O, der größer ist als du. Im Rahmen des runden Buchstaben O genießt
du zu leben, während dir das kleine goldene Zeichen o den Ringfinger
drückt. Wenn du es abnimmst und betrachtest, siehst du, dass du
nicht hindurch kannst. Du steckst es wieder an, an den immer
gleichen beringten Platz.
Diese Einfälle zum großen und zum kleinen „o“ werden in eine
schöne, lesbare, aber völlig nebulose Sprache gefasst. Wenn
wir uns Roland Barthes anschließen, so begehrt nicht nur der
Leser (manchmal) den Autor (Gestalt, Gesicht, Ausstrahlung, Stimme
usw.), sondern auch der Autor (manchmal) den Leser (Witz, Humor,
Bildung, Weltanschauung etc.). Der Text ist ein Fetisch, der den
Leser begehrt… durch das Vokabular, durch die Bezüge, durch die
Lesbarkeit (R. B., Die Lust am Text, 1980, S. 43)
Um die schwachen Bezüge des obigen Textes zu verbessern, schreibt
man das Ganze um. Das klingt nun so:
Warum bist du so grell lebendig, dass du nicht leben kannst? Du lebst
mit dem fröhlichen Buchstaben o, begehrst aber den großen Buchstaben
O, der größer ist als du. Im Rahmen des runden Buchstaben O möchtest
du leben, während dir das kleine goldene Zeichen o den Ringfinger
drückt. Wenn du es abnimmst, siehst du, dass du nicht hindurch kannst.
Du steckst es wieder an, an seinen alten Platz.
Wirklich klar sind die Sätze dadurch nicht geworden, doch das spürbar
Unlogische des Hintergrunds ist eliminiert. Es gibt zB. keinen Ring mehr,
der abgenommen wieder zurückgesteckt wird auf den „beringten Platz“.
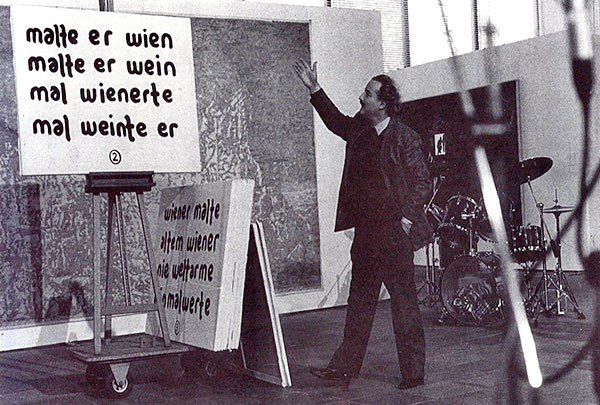
Literarischer Minimalismus im Museum, 1982
Ein mit Preisen überhäufter, aber wenig gelesener Autor, Peter Waterhouse,
hat in einem Gedicht (Passim, In: gangan viertel 4/ 1987) noch viel vagere
Bezüge als Milena Merlak:
Wir stehen auf den eigenen Füßen des Sommers/ zu spüren ist/
der Beginn, der alles meint/ im Mund sind wir Kölner/ im Mund
geht auch die Birne auf und ab/ und wird zerlegt in alles, was
gemeint ist.
In diesem Gedicht kann man drei entscheidende Wörter folgenlos
austauschen. Man kann „Frühling“ statt „Sommer“, „Linzer“ statt
„Kölner“ und „Apfel“ statt „Birne“ sagen, ohne dass die poetische
Gebärde des Ganzen verändert wird.... Inhaltliche Beliebigkeit
vermindert den Wert schöner Worte. Der Leser trifft nur auf ein
oberflächliches Sprachgefühl, das (in einer seltsamen Hybris)
die Form absolut setzen möchte, was gar nicht geht, durch
Rhythmisierung, Geometrisierung etc., während er die starke,
unlösbar mit Inhalt verbundene Form, die eine Tiefenlektüre
ermöglicht, gar nicht findet.
Autoren, die nur den Nachweis ihrer sprachlichen Selbstkontrolle
erbringen und ansonsten die Wirkungslosigkeit ihrer Texte
rechtfertigen (Ich habe nichts erlebt! Ich habe nichts zu
sagen! Die wenigsten werden mich verstehen!) soll es zwar
geben, aber man sollte immer dazusagen, dass sie mit der
Gefahr der Wertlosigkeit von Dichtung herumspielen. Durch
Minimalismus.
Sogar ein stärkerer Autor, der Erzähler Wolfgang Herrndorf, hat
sich in einem Blog- und Tagebuchtext, der täglich zu schreiben
war, an manchen Tagen die Beliebigkeit des Inhaltes erlaubt:
ich denke an Dürer, der tot ist, warum ausgerechnet an Dürer,
ich weiß es nicht, an einen seit fünfhundert Jahren toten Maler, der
seine Badefrau gezeichnet hat, der ihr gegenübersaß und sie
zeichnete, der mit ihr redete, kein Mensch weiß, worüber, und sie
waren glücklich oder unglücklich, verschämt oder aufgekratzt,
verliebt oder gleichgültig, für ein paar Minuten oder Stunden, waren
einmal reale Wesen in einer realen Welt, was man sich nicht
vorstellen kann. Ich kann es mir nicht vorstellen. Und die Absurdität
macht mich verrückt. (W.H., Arbeit und Struktur, 2013, S. 160)
Vielleicht meinte er, dass der Gedanke, hic et nunc zu leben und
morgen tot zu sein, etwas Unerträgliches hat. Dass er ein logischer
Skandal ist. Doch das hat er nicht gesagt. Er formulierte nur Sätze,
die einander mit Schwung folgen und dann im persönlichen Gefühl
versacken. Er kann sich Dürer und sein Modell nicht vorstellen. In
Wahrheit leben alle historischen Romane und jeder zweite Spielfilm
von genau dieser Fantasie.
Autoren, die in ihrem Schreiben das eigene Gesetz nicht
suchen, geschweige denn finden, nur schauen, was die anderen
machen, und versuchen, es genauso zu machen (Herrndorf),
werden für den Inhalt ihrer Sprachwerke keine Verantwortung
übernehmen. Sie werden undeutliche Bezüge zulassen
und ihre Einfälle nur formal, nicht auch inhaltlich überprüfen.