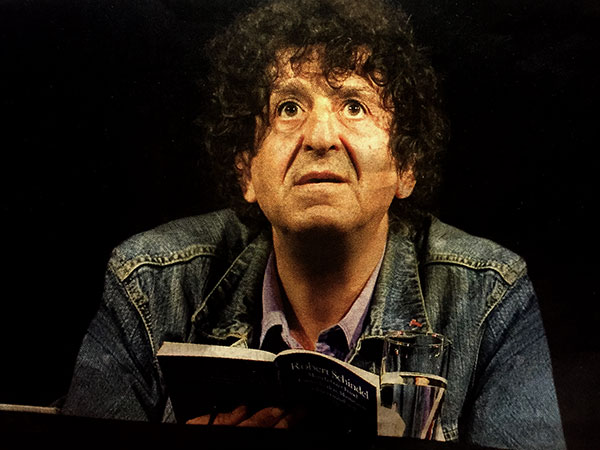Der Erzähler, der in seinem Text nicht ständig dazusagt, dass er
nichts weiß, sollte nach Auffassung von W. G. Sebald gar nicht
vorkommen. Diese letztlich maßlose Meinung zitiert James
Wood in seinem Buch „Die Kunst des Erzählens“: Jegliche Form des
auktorialen Schreibens, bei der sich der Erzähler als Bühnenbildner,
Spielleiter oder Richter und Vollstrecker einsetzt, finde ich unhaltbar.
(J.W., Reinbek 2011, S. 20) Er zitiert Sebald und nicht sich selber.
Jener Kunstideologe sagt zwar „ich“, aber er meint „man“. Und
er kann auf Wettbewerb und Vielfalt verzichten, ihm kann das
Spiel der Kunsthaltungen und Stile gestohlen bleiben, es soll
aufhören, zugunsten der von ihm bevorzugten Kunst.
Was macht nun der allwissende Erzähler, dass er so unhaltbar ist
und nicht länger ertragen werden kann? Ein Autor, der die Auktorialität
erneuerte und für alle Großen der US – Literatur Erzählmodelle
lieferte, war Sherwood Anderson. Er schreibt: Abends, wenn der Sohn bei
seiner Mutter im Zimmer saß, fühlten sich beide verlegen wegen
ihres Schweigens. Es wurde dunkel, und der Abendzug lief in die
Station ein. Unten auf der Straße stapften Füße auf dem hölzernen
Bürgersteig auf und ab. Und wenn dann der Abendzug abgefahren
war, lastete die Stille über dem Bahnhofsgelände. Höchstens, dass
Skinner Leason, der Expedient für das Eilgut, noch einen Lastkarren
die Laderampe entlang schob. Die lachende Stimme eines Mannes
klang von der Main Street herüber. Die Tür des Frachtkontors wurde
mit einem Knall zugeschlagen. George Willard erhob sich, ging durchs
Zimmer und tastete nach dem Türgriff. Es kam vor, dass
er gegen einen Stuhl stieß, der dann über den Fußboden schurrte.
Die Kranke blieb am Fenster sitzen, ohne sich zu regen und wie
teilnahmslos. Ihre langen Hände hingen weiß und blutleer über das
Ende der Armlehnen ihres Sessels. ´Ich glaube, es ist richtig,
du gehst jetzt zu den anderen Jungen hinaus. Du hockst zu viel
zu Haus´, sagte sie, um ihm den Entschluss zum Weggehen zu
erleichtern. (Sh. A., Winesburg Ohio, Frankfurt/Main 1973, S. 26 f.)
Der Autor hat sich eine von außen kommende Erzähler-Stimme
geschaffen, die sich der Stimme keiner einzigen Figur annähert.
Die Figuren sprechen anders als er. Er ist kein Richter und Vollstrecker,
sondern urteilt vorsichtig und ausgewogen (fühlten sich beide verlegen
etc.). Er weiß mehr als die Figuren wissen (Höchstens, dass
Skinner Leason etc.), aber doch nicht alles (Die lachende Stimme eines
Mannes etc.). Er hat einen Überblick über die Zeiträume (Es kam vor,
dass etc.) und er kennt die Motivationen für das Reden und
Handeln der Figuren (um ihm den Entschluss zum Weggehen
zu erleichtern). Trotz seines überlegenen Wissens distanziert
er sich nirgendwo von den Figuren, sondern legt im Gegenteil
ein warmherziges Mitfühlen an den Tag, er wirbt gleichsam um
Verständnis für die Gewöhnlichkeit oder die Absonderlichkeit
der Figur.
Etwa zwanzig Jahre später ist die auktoriale Stimme etwa bei
John Dos Passos stark verändert. Dem warmherzigen Erzähler, der
für seine Figuren spricht und dem der Leser vertrauen kann, wird in
den 1930 ern nicht mehr geglaubt. Die Stimme klingt nun so:
Stevens kam durchs Zimmer auf Dick zu und fragte ihn, was für ein
Mensch Moorehouse sei. Dick errötete. Er ist ein außerordentlich
tüchtiger Mann, stotterte er. – Ich hatte den Eindruck, dass er nur eine
ausgestopfte Puppe ist… Ich habe auch nicht begreifen können, was
diese verfluchten Schafsköpfe von der bürgerlichen Presse sich
eigentlich für ihre Blätter erwarteten. Ich war für den Londoner Daily
Herald dort.
Ja, ich habe Sie gesehen, sagte Dick.
Nach dem, was mir Steve Warner gesagt hat, war ich der Meinung,
Sie gehörten zu den Leuten, die von innen her Zersetzungsarbeit
leisten!
Zersetzen und sich zersetzen lassen!
Stevens beugte sich über ihn, starrte ihn an, als wolle er ihm eine
runterhauen. Na, wir werden ja bald wissen, in welchem Lager jeder
steht. Es dauert nicht mehr lange, dann werden wir alle unser Gesicht
zeigen müssen, wie man in Russland sagt.
Eleanor unterbrach sie mit einer frischen, dampfenden Flasche
Champagner. Stevens kehrte zum Fenster zurück, um sich mit Eveline
zu unterhalten. Ebensogern möchte ich einen Baptistenprediger
im Haus haben!, kicherte Eleanor.
Hols der Teufel, ich kann Menschen nicht ausstehen, die sich nur dann
amüsieren, wenn sie anderen das Leben sauer machen, brummte Dick
leise. Eleanor lächelte ein schnelles, spitzes Lächeln und gab ihm
einen Klaps auf den Arm (J.D.P., Neunzehnhundertneunzehn, Reinbek
1979, S. 534)
Die Stimme, die bei Dos Passos spricht, ist verglichen mit
Anderson, unpersönlich. Jean Paul Sartre bezeichnete sie als
„Chor“ (J.P.S., Der Mensch und die Dinge, Reinbek 1978, S. 18 ff.).
Sie erzählt quasi – journalistisch von Menschen, Situationen
und Ereignissen, die nicht frei erfunden sind, sondern größtenteils auf
Dokumenten beruhen. Dos Passos bringt sogar die Bruchstücke
dieser Dokumente als „Kameraauge“ und „Weltwochenschau“ zwischen
seinen Texten. Die Figuren stehen unkommentiert da und auch ihre
Handlungen werden von der Chor – Stimme nur minimal beurteilt
(lächelte ein schnelles, spitzes Lächeln etc.). Da ein Reporter üblicherweise
einen Mittelwert liefert, nämlich das, was jeder sehen und hören
kann, die Figuren aber individuelle, durch Zufälle gebogene
Lebenswege gehen, entsteht eine Anregung für den Leser. Der
Leser sagt sich: Der Mensch lebt sein Leben, ohne dass es ihm
vorgeschrieben wird, und ist dennoch überhaupt nicht frei.
So hat er es gemacht. Dos Passos dachte sich die Lebenswege
der Figuren selber aus, gestaltete aber die Figuren mit dem On Dit
der Gesellschaft. Das war eine Abänderung des auktorialen
Schreibens, durch die er über die fiktive Welt des Textes
hinaus wirkte. Der Leser denkt über das Schicksal der Figuren
nach, ohne dass der Autor ausdrücklich wird und ihn belehrt.
Dadurch ist der Hauptvorwurf an die Adresse des allwissenden
Erzählers entkräftet. Der diskrete Spielleiter bleibt allerdings
erhalten (doch wo gibt es diesen nicht?), aber der Vorwurf der
Hochstapelei ist gegenstandslos geworden. Ein Autor von der Art
des Dos Passos täuscht kein größeres Wissen vor, als er
hat, er zeigt im Gegenteil die Spitze des Eisberges, er hat mehr
Material, als er überhaupt gestalten kann.
Beim personalen Schreiben ist das Wissen des Erzählers nicht
verschwunden, wird aber nicht ganz ernst genommen, vielleicht
sogar ständig in Frage gestellt. Als Beispiel die Icherzählerin bei
Ingeborg Bachmann, eine hascherlartige Frau, die dennoch in die
Handlung eintritt: Wenn der Fahrtwind nicht wäre, würde ich bitterlich
weinen, auf dem halben Weg nach Sankt Gilgen, aber der Motor
stottert, wird ganz still. Atti wirft den Anker, das ganze Ankergeschirr
hinaus, er schreit mir etwas zu, und ich gehorche, das habe ich gelernt,
dass man auf einem Boot gehorchen muss. Nur einer darf etwas sagen.
Atti kann den Kanister mit dem Reservebenzin nicht finden, und ich denke,
was wird wohl aus mir werden, die ganze Nacht auf dem Boot, in
dieser Kälte? Es sieht uns ja niemand, wir sind noch weit weg
vom Ufer. Aber dann finden wir den Kanister doch, auch den Trichter.
Atti steigt vorne aufs Boot, und ich halte die Laterne. Ich bin nicht
mehr sicher, ob ich wirklich noch an ein Ufer kommen möchte.
Der Motor springt aber an, wir ziehen den Anker ein, fahren schweigend
nach Hause, denn Atti weiß auch, dass wir die ganze Nacht auf dem
Wasser hätten zubringen müssen. Zu Antoinette sagen wir nichts,
wir schmuggeln Grüße ein von drüben, erfundene Grüße, ich habe
den Namen der Leute vergessen. Ich vergesse immer mehr. Es fällt
mir beim Abendessen auch nicht ein, was ich Erna Zanetti, die mit
Antoine in der Premiere war, ausrichten sollte oder wollte.
(I.B., Malina, Frankfurt/Main 1983, S. 172)
Im Text der Bachmann wird assoziiert und bruchstückhaft erzählt,
das ist von Reiz. Es entsteht aber eine Dauerspontaneität, die
es dem Text nicht erlaubt, die Aufmerksamkeit des Lesers jemals
anzuspannen. Das plappernde Bewusstsein erschöpft sich bald.
Und es ist auch nicht die Welt, in der die meisten Menschen leben.
Literarische Figuren haben nicht nur die scheinbare Zeitlosigkeit
des Innern, sondern auch die Chronologie äußerlicher Handlungen
nötig. Zusammenfassend lässt sich sagen: Das personale Schreiben,
(das „Malina“ hervorbrachte) stellt die innere Welt auf Dauer
und lässt die äußere in Bruchstücken darin auftauchen, aber es liefert
– wie das auktoriale Schreiben – nur eine Teilansicht der Welt.
Es lässt den handelnden Menschen weg.
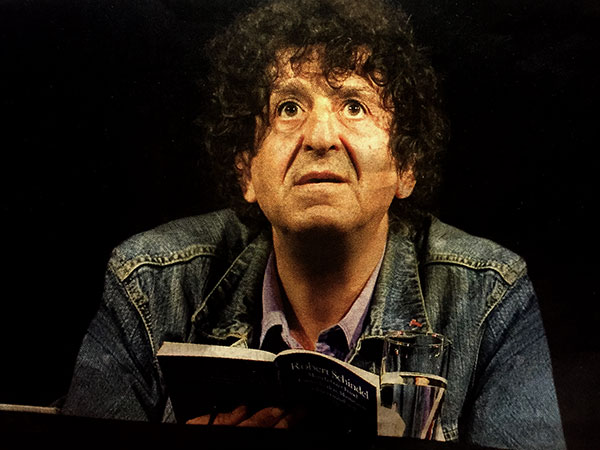
Robert Schindel hat den auktorialen Spielleiter benutzt (in einem
Roman über das Erinnern an den Holocaust) und dabei nicht
nur die Auf- und Abtritte seiner Figuren geregelt: er stapelte den
Artikel zusammen und eilte zu seinem Chef. Klingler hielt ihm die
Hand hin. Geben Sie her, geben Sie her! Er las, schnaufte dabei,
lächelte.
Nanu, an?, Klingler drehte das letzte Blatt um, sah unter seinen
Schreibtisch. Da fehlt doch was. Kürzen Sie in der Mitte bissl und
kommen Sie zum Ende.
Er gab ihm den Artikel zurück, erhob sich und ging zum Fenster.
Und mildern Sie das Ganze etwas. Der Zorn ist ein mäßiger
Autor!
Schreiben Sie es zu Ende, sagte Apolloner und wollte ihm den
Artikel auf den Schreibtisch legen.
Seien Sie nicht kindisch, sagte Klingler und drehte sich zu ihm.
Glauben Sie, mir schmeckt das? Lassen Sie die Wortspiele
draußen und schreiben Sie noch etwas über die österreichische
Krankheit. Das haben Sie schön angedeutet, aber eben nur angedeutet.
Kommen Sie Roman, kühler Kopf zum heißen Herzen. Kühler
Kopf! - Klingler schaute auf seine Armbanduhr. Bis um
fünf.
Um halb sechs lieferte Apolloner den Artikel ab, fuhr ins Pick Up
und stellte sich neben Karl Fraul an die Bar.
Ich weiß selbst nicht, warum ich in eine derartige Dauerwut
hineingeraten bin. Ich ging im Pick Up zum an der ersten Bar
lehnenden Karl Fraul, stellte mich neben ihn, klopfte ihm auf den
Oberarm und strebte weiter zur zweiten Bar, an welcher niemand stand.
Fraul hatte mir ein heiseres ´Servus Roman´ hingesagt. Nun drehte
ich mich um und schaute zu Fraul zurück, der mit dem Rücken zu mir
ein neues Bier orderte. (R.S., Der Kalte, Frankfurt/Main 2014, S. 233f.)
Schindel gibt die äußeren Handlungen in dürrer Sprache wieder
und beendet sie nur deswegen, um eine Innenwelt einzuschalten.
Diese liefert keine eigene Sprache der Figur, sondern bietet nur
jene Auktorialität, die sonst überall den Text dominiert. Damit ist der
Sinn dieses Wechsels von Auktorial und Personal verfehlt. Der
allwissende Erzähler soll nicht der heimliche Herr von personalen
Innenwelten sein, sondern besser zusammenfassen, behutsamer
urteilen und mehr wissen.
© M.Luksan, Oktober 2015
|