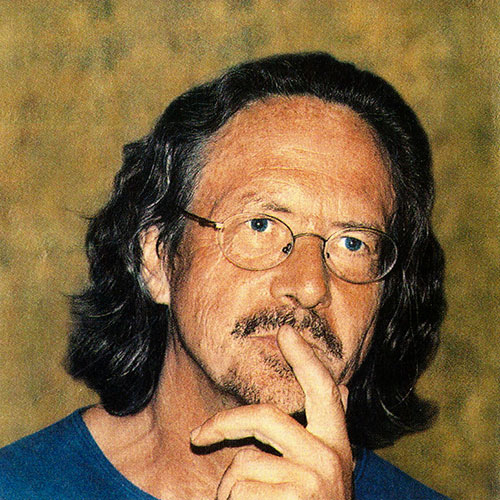Menschen, die extreme Lagen überstanden, wissen in der Regel
gut, wer sie sind. Sie teilen aber selten ihre extremen Erfahrungen
optimal mit. Auch jene Wild – Bewegten, von denen man glaubt,
dass sie viel Selbstreflexion geübt haben, sagen oft fast nichts. Die
Täter sind noch sprachloser als die Opfer. ZB. Jack Unterweger fand, dass
sein erster Mord eine „Affekthandlung“ gewesen war, obwohl er einen in die
Länge gezogenen Sexualmord begangen hatte. Und Helmut Frodl, der Filmregisseur, der einen Mord von langer Hand geplant und blutig
hatte verbergen wollen, fand für seine Wahnsinnstat nur das Wort „Kommunikationsabbruch“.
Sehr gescheite und kreative Köpfe aus dem philosophisch-literarischen
Bereich, wählten für einen Abschnitt ihres Lebens oder für ihr ganzes
bisheriges Leben nur blasse Worte. „Ich lebte“, schrieb Albert Camus, „in beschränkten Verhältnissen, aber auch in einer Art Genuss. Ich verspürte unendliche Kräfte in mir und musste nur herausfinden, wo ich sie einsetzen
konnte“ (A.C., Licht und Schatten, In: A.C., Kleine Prosa, Reinbek 1961,
S. 31) Er konnte oder wollte offensichtlich nicht konkreter werden.
Und Jean-Paul Sartre schrieb am Ende eines nobelpreisgewürdigten
Buches: „Ich behaupte in aller Aufrichtigkeit, nur für meine Zeit zu schreiben,
aber meine jetzige Berühmtheit geht mir auf die Nerven, denn ich lebe ja“
(J.-P. S., Die Wörter, Reinbek 1965, S. 195) Er fand es richtig, eine
Unlust schaffende Berühmtheit nicht zu erklären, sie als selbstverständlich vorauszusetzen.
Ab 1990 fingen die Promis damit an, dass sie eine abweichende und tabuisierte Eigenheit öffentlich einbekannten. ZB. Abhängigkeit von Kokain, Homosexualität,
Freude an Faustfeuerwaffen usw. Sie taten das, um ein welkes
Image aufzufrischen. Das konnten sie durch die Mitteilung einer Tugend
nicht bewirken, das hätte den Eindruck von Angeberei vermittelt, es
musste schon eine Schwäche sein. Dieses „Outing“ war natürlich nichts
Neues. Schon zwischen den Weltkriegen, als jeder Einzelne noch im
Schatten von Weltpolitik stand und insofern sein Ich nicht beliebig
ausbreiten konnte, outete sich der Völkerkundler und Literat Michel
Leiris in einem Prosawerk. „Einige Gesten“, schrieb er, „waren oder
sind mir eigen: meinen Handrücken beschnuppern; meine Daumennägel
fast bis aufs Blut kauen; den Kopf leicht zur Seite neigen; die Lippen
zusammenkneifen und die Nasenflügel mit einem entschlossenen
Ausdruck einziehen; plötzlich mit der flachen Hand an meine Stirn
schlagen (…); meine Augen hinter meiner Hand verbergen, wenn ich
gezwungen bin, auf etwas zu antworten, das mich in Verlegenheit setzt;
wenn ich allein bin, mir die Analgegend zu kratzen; usw.“ (M.L.,
Mannesalter, Frankfurt/M. 1975, orig. 1939, S. 24) Schon an der
Sprachform des Ganzen wird die Aporie ersichtlich. Je länger die
Aufzählung solcher Eigenheiten ist, desto größer ist die Zahl der
weiteren Fragen nach dem realen Monsieur Leiris, die allesamt offen
bleiben.
Niemand kann behaupten, dass ein Autor oder eine Autorin über
die Sprache und die Zeit verfügen, das eigene Ich vollständig mitzuteilen.
Es ist aber eine große Durchmischung zu sehen, bei der sich
Literatur, Journalismus und Autobiografie gegenseitig durch-
dringen und die Damen und Herren Gestalter die Möglichkeit erblicken,
das Ich gleichsam im Rohzustand darzubieten. Nicht distanziert und
künstlerisch bearbeitet als ein kleines Stück Poesie, sondern als
ein Originalzitat aus dem Innenleben, das der Leser deuten soll.
In einem Sprechakt kann die Ichmitteilung bereits dadurch gelingen,
dass der Sprecher den Schauspieler seiner selbst aktiviert. Die
Überzeugungskraft verbraucht sich hier im Moment, die Falschheit
der Mitteilung kann erst hinterher erkannt werden. Beim geschriebenen
Wort läuft der Vorgang kühler ab, der Leser kann nicht überrollt werden
und die Echtheit des Ich lässt sich eo ipso nicht behaupten. Der Autor
muss seine Eigenheiten in ineinander greifenden Sätzen ausbreiten und
muss dabei überall zutreffend formulieren. Früher wurde für die Ichmitteilung
der fiktive Erzähler eingesetzt, heute spricht der Autor mit eigener Stimme. Außerdem warnt er den Leser davor, der Selbstenthüllung Glauben zu
schenken. Denn auch er, der Autor, sei schließlich nur ein Mensch, ein
Lügner, ein Spaßmacher, wie alle andern auch. So muss letztlich der Leser
entscheiden, ob er das Geschriebene ernst nehmen will oder nicht.
Die meisten Leser wählen, wenn sie zwischen der Wahrheit der Darstellung
und dem brillanten Sprachspiel die Wahl haben, das Gewicht der
Fantasie. Deswegen gewinnt in der Bekenntnisliteratur jener Autor
oder jene Autorin, die sich in ihrem sozialen Umfeld beschreiben.
Sie machen dadurch ihr Ich konkret und auch verständlich. Friedrich
Christian Delius, Autor und Ex-Lektor (Wagenbach), hat sein Ich im
Literaturbetrieb beschrieben und es dadurch verbindlicher gemacht
als zB. das auf Intimitäten bezogene und trotzdem märchenhafte
Ich des Monsieur Leiris. Leider hat er auf die Kunst vergessen.
„Ich sah diesen Augen an“, schreibt er über einen Blick von
Erich Fried, dass sie mich durchschauten, sie durchschauten in
diesen Sekunden den ängstlichen, ehrgeizigen Jüngling, der ich war
(…) Wer bin ich denn, ein Urteil zu fällen? Ein Urteil über Fried, ein
Urteil über sein Prosabuch, Urteile über andere Autoren, andere Bücher,
über wen oder was auch immer. Wer bist du denn? (…) Ich beneidete
sie nicht, die mächtigen Männer mit der richterlichen Gewalt und der
extrovertierten Klugheit. Keiner von ihnen, schätzte ich, hätte sich
von der Frage irritieren lassen, die ich in Frieds Blick gelesen hatte,
Wer bist denn du, ein Urteil zu fällen?“ (H.C.D., Als die Bücher noch
geholfen haben, Berlin 2014, S. 34, 35, 36)
So wird bei Delius zwar ein wahrhaftiges, aber auch ein ödes
Ich sichtbar. Das mitgeteilte Ich ist öde, Delius selbst ist
vermutlich spritzig. Statt eine poetische Form für sein Ich zu finden,
hat der Autor sein Ichgefühl moralisch und aus großer zeitlicher
Distanz beschrieben („Ich beneidete sie nicht, die mächtigen Männer“ –
damals wird er sie wohl beneidet haben). Ein anderer - als
Journalist weltbekannter - Autor, verfehlt sein vermutlich interessantes
Ich durch die Betonung seiner Heldenaufgabe. Diese erfüllt er als
Mafia – Aufdecker. Roberto Saviano arbeitet in Carabinieri – Kasernen
und in wechselnden Wohnungen, hat Personenschutz und wird vom
italienischen Staat hoffentlich gut beschützt. „Dieses Buch“, schreibt
er, „ist für alle, die meine Worte aufgegriffen, sie an Freunde und
Verwandte weitergegeben und sie in die Schulen getragen haben.
Alle, die in der Öffentlichkeit daraus zitiert und damit zum Ausdruck
gebracht haben, dass mein Anliegen zum Anliegen aller geworden ist,
weil meine Worte in aller Munde sind. Ihnen allen gilt mein Buch, denn
ich weiß nicht, ob ich es ohne sie geschafft hätte, weiterzumachen,
Widerstand zu leisten“ (R.S., Die Schönheit und die Hölle, Berlin 2010,
S. 18) Er analysiert in keiner Weise, warum er seine lebensgefährliche
Tätigkeit begann – die Hoffnung auf den Dank eines Publikums
wird es nicht gewesen sein.
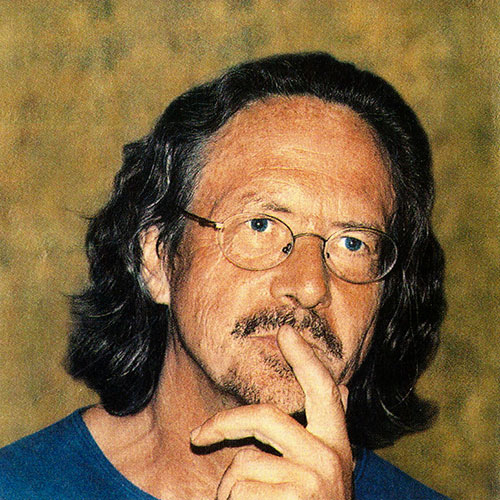
Im Rohzustand sagt das Ich zu wenig oder zu viel aus, darum wird es
kommentiert. Die vielen Kommentare zerreden die Qualität des Ichgefühls
oder fügen im Nachhinein eine Qualität hinzu, die ursprünglich nicht
gegeben war. Warum also nicht mit Hilfe der Kunst die wichtigste
Bedeutung schneller finden?! Bei Ichqualitäten sollte man nicht
ausschließen, dass die Kunst sogar die Wissenschaft übertrifft,
insofern sie das Wesentliche, das das Notwendige ist, intuitiv erkennt
und auf engem Raum, gleichsam auf den Punkt hin, darstellt.
Peter Handke hat das noch gekonnt. Er war fähig, das Subjektive in
Richtung Typik zu überwinden, zB. in seinem Erinnerungsbuch über
seine Mutter. „Noch immer“, schrieb er, „wache ich in der Nacht
manchmal schlagartig auf, wie von ihnen her mit einem ganz leichten
Anstupfen aus dem Schlaf gestoßen, und erlebe, wie ich mit angehaltenem
Atem vor Grausen von einer Sekunde zur anderen leibhaftig verfaule.
Die Luft steht im Dunkeln so still, dass mir alle Dinge aus dem
Gleichgewicht geraten und losgerissen erscheinen. Sie treiben nur eben
noch ohne Schwerpunkt lautlos ein bisschen herum und werden
gleich endgültig von überall niederstürzen und mich ersticken.“
(P.H., Wunschloses Unglück, Frkf.M. 1975, S. 99) Der findige Dichter hat
das durch Bluthochdruck oder Restless Legs oder sonstwas bewirkte
Aufwachen poetisch gut beschrieben. Er hat außerdem diese
Angst und diese Panik mit dem Gedanken an den Freitod seiner
Mutter verknüpft. Das ungute Aufwachen und der Gedanke an den
Tod der Mutter könnten getrennt geschehen sein. Das wäre egal,
denn es spricht nicht gegen die von Handke angewandte Kunst,
das Typische mit dem Einmaligen zu verbinden.
© M.Luksan, Jänner 2017
|