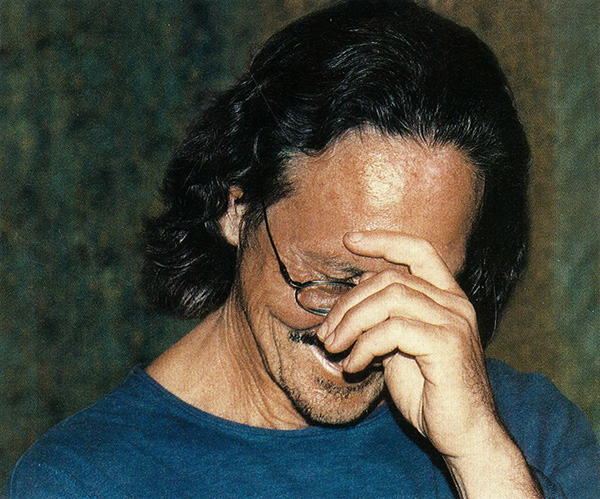|
STARTSEITE
|
Peter Handke - die Entdeckung der Persönlichkeit |
|
„Erst viel später“, erzählt Amina Handke über ihren Vater, „habe ich ihn
gefragt, was gewesen wäre, wenn er nicht berühmt geworden wäre (…)
Getrunken hätte er sicher mehr.“ (A.H., Interview, In: Der Standard, 2.12.17)
Der Erfolg des Peter Handke hat ein Menschenleben in die Zone des
Glücks gedreht. Sehr wahrscheinlich. Der deutsche Betrieb wartete auf
ein bestimmtes, singuläres Talent, und da kam es, zur rechten Zeit.
Weniger das Werk als die junge Persönlichkeit des Künstlers trat
anfangs hervor und sie stellte sich neben ihren Werken auf. Man
wusste dann mehr von diesem Autor als von seinem Werk. ZB. Das
Wort „Ich möchte einmal einer sein, der ein anderer gewesen ist“
galt als Weisheit und niemand hätte um 1970 herum dieses Wort
entzaubert. „Warum sagt er nicht: Ich möchte mich verändern?“
Die Situation der Kunst beiseite. Interessant ist der Gedanke, dass man die Konzentration aufs Werk erhöhen könnte, wenn man als Autor verschwindet. Dabei ging es weniger um das Verstecken des Quartaltrinkers Faulkner als um die Betonung des Umstands, dass er sich für sein Werk aufgeopfert hatte. Den Mythos der Selbstaufopferung sah der englische Literaturkritiker Cyril Connolly durch Technik zerstört. „Radio, Setzmaschine und Kino“, schrieb er, „diese Erfindungen haben den Wirkungsbereich des 1 Künstlers ungeheuer erweitert, aber sie liefern ihn mehr denn je der Staatspolitik und den Wünschen der Ignoranten aus (…) Es mögen neue Leonardos des Films und des Mikrophons aufstehen (…), aber erst dann, wenn alle anderen Künste auf das Niveau eines provinziellen Handwerks herabgesunken und Luxus geworden sind“ (Das Grab ohne Frieden, Frankfurt a. Main, 1962, S. 81 f.) Der viel wissende und selbst forschende Peter Handke ist so eine Art Leonardo. Wie Goethe hat er stets die Künstler-Autonomie betont, sie manchmal sogar gegen den Betrieb aufgerichtet, aber er hat seine eigene Sphäre nie verlassen. Über diesen Schatten hätte er springen können. Er hat sich ferner - durch Beachtung von Literaturideologie - zusätzlich geschwächt. Er hat die Gestaltung von Nichtich – Erfahrungen abgeschafft. Schluss gemacht mit der Neugierde an der ganzen Welt. Die Handkesche Poesie, dieses Hin - und Her - Wenden der Wörter und der Sätze, wurde in einem defensiven Leben praktiziert, das zwar nicht durch Menschenhass, aber doch durch die Idee einer Selbstheilung motiviert war, die zugleich das Vorbild für eine Weltheilung hatte sein wollen. Als Connolly den jungen Autoren und Autorinnen zugerufen hatte: „Sie leben nicht richtig! Sie leiden nicht stark genug!“, hätte Handke antworten können: „Ich lebe und schreibe so, dass ich eines Tages nicht mehr zu leiden brauche.“ Diese Selbstheilungsidee war den Literaturideologen in Deutschland so wichtig, dass sie gleich die deutsche Sensibilisierungs- und Befindlichkeits-Prosa ausriefen. An deren Ursprung steht Handke. Er reicht darüber hinaus. Die drei Fehler des Connolly, Faulheit, Eitelkeit und Feigheit, scheinen ihm zu fehlen („Wenn einer zu faul ist, um zu denken, zu eitel, um eine Sache schlecht zu machen, und zu feige, um dies einzugestehen, dann wird er nie weise werden“, C.C., a.a.O., S. 34), und konsequent, wie er auch ist, lebt und schreibt er gemäß seiner Verhältnisse. „er hat sich die Hand gebrochen“, erzählt Amina Handke, „als er gegen den Gartenzaun geschlagen hat in seinem Haus in Charville. Der Hund vom Nachbarn hatte so laut gebellt, und da ärgert er sich immer, also schlug er mit einem dicken Goethe-Buch in der Hand gegen den Zaun und brach sich den Mittelhandknochen“ (A.H., a.a.O.) Ein Affekt, den man von sich selber kennt, ist hier mit Ungeschicklichkeit verknüpft. Handke stopft auch gerne seine Socken, anstatt sich neue zu kaufen, er macht ständig Spaziergänge, und er bastelt an einer Familien-Mythologie, in der ein Onkel, den er nie kennen gelernt hat, die wichtigste Figur ist. Von den Socken abgesehen, ist er ein Mensch wie du und ich. Warum ist das nicht erhellend? Weil Peter Handke in seinem Werk ohnehin nur über sich selber schreibt. So ähnlich hatte man ihn sich vorgestellt. In den 1970 er Jahren hätte man von Handke gerne ein Porträt des argen Siegfried Unseld gelesen (wie es zB. Thomas Wolfe 2 in seinem Buch „Es führt kein Weg zurück“ über den argen Ernst Rowohlt geliefert hatte). Doch der Dichter gebrauchte seine schöne und genaue Sprache lieber für eine sexuelle Anwandlung beim Auftauchen eines Frauengesichtes in einem Fenster („Die Stunde der wahren Empfing“) oder für ein Glücksgefühl beim Angehen der Straßenbeleuchtung („Die Lampen auf der Place Vendome“), als für die Beschreibung seines oberflächlichen und sich mit Künstlern schmückenden Verlegers. War er fromm bei Personen, die im Betrieb etwas zu sagen hatten? Schwer zu sagen. Von Albert Camus stammt die Bemerkung, dass gerade der erfolgreiche Autor aus Stolz und Ergebenheit wild gemischt ist. Der fabelhaften Sprache von Peter Handke stand und steht nicht die ganze Welt offen. Er kann nicht – wie es zB. Faulkner konnte - sich alle Iche seiner Welt durch eine helle, weil durch Wissen geprüfte und ergänzte Fantasie zugänglich machen. Er kann nur sein eigenes Ich und seine Welt auf ichhafte, subjektive Weise darstellen. So kann er seine Welt nicht ernsthaft kritisieren. Doch er kann wirklich glauben, dass das eigene Leiden weiter abnimmt und in der Todesstunde am Geringsten ist. Das tägliche Schreiben, um sich selbst zu erforschen, und das regelmäßige Produzieren, um nicht in Vergessenheit zu geraten, machen es möglich. Jedes Jahr ein Buch herausbringen, einfach weil Schreiben für einen die beste Lebensform ist, verringert die Bedeutung von Literatur. „Als ich angefangen habe“, erzählt Amina Handke, „seine Bücher zu lesen, habe ich mir schon manchmal gedacht: Kaum hatte ich eines fertig gelesen, waren schon wieder drei neue heraußen (…) Die Versuche gingen ja noch, die waren ja dünn. Aber nicht diese 900 Seiten – Teile. Da hab ich mir dann schon gedacht: Na geh bitte! Jetzt muss ich das auch lesen.“ (A.H., a.a.O.) Der Autor Handke war längere Zeit der Motor eines kreativen Prozesses. Von seinen Anfängen bis in die 1980 er Jahre wurde er immer interessanter und immer dichter. Doch irgendwann hörte das ganz auf (ein Thema für die Literatur- forschung!) und die weit ausgebreitete Persönlichkeit war zum eigentlichen Lesemotiv geworden. Der Prozess war für den Autor eine Art Selbstheilung, doch für die Verlage war er ein Marketing-Kniff. Eine Entschädigung für das sich abzeichnende Schwachwerden der Literatur durch einen neuen Lese-Anreiz. © M.Luksan, Mai 2018 |
|
|
|
|